In der Genderfalle
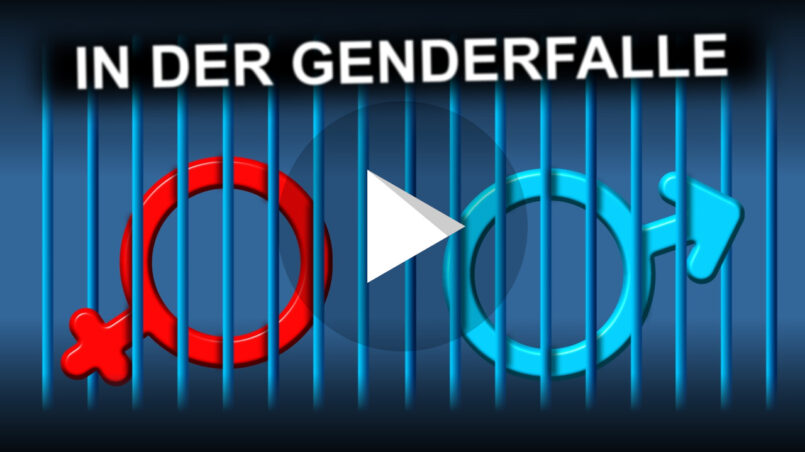
Als ich 1994 maturierte, gab es das Wort „gendern“ im Alltag noch nicht. Es gab einen Lehrer und eine Lehrerin und einen Direktor und eine Direktorin. Sobald die Mehrzahl der Menschen gemeint war, wurde selbstverständlich die männliche Form angewandt – grammatikalisch als das „generische Maskulinum“ definiert.
Irgendwann Anfang des neuen Jahrtausends kam eine Diskussion zum Text der Bundeshymne auf, dicht gefolgt vom Ansinnen des Genderns in den Medien. Im Nachhinein gesehen hätten wir uns damals auf das Sprichwort „Wehret den Anfängen“ besinnen sollen. Aber kaum jemand nahm das ernst, schließlich gab und gibt es andere Probleme als die ach so patriarchalische Passage „Heimat bist du großer Söhne“. Obwohl 2012 der Text offiziell geändert wurde, kenne ich so gut wie niemanden, der die neue Fassung singt. Auch ich lasse weiterhin die Töchter weg, weil die Zeile viel flüssiger von den Lippen geht. Schließlich gibt es (noch) keine Strafen für das Singen der alten, heute „falschen“ Variante.
Anders verhält es sich an der Universität. Wer sich dort dafür entscheidet, in einer wissenschaftlichen Arbeit nicht zu gendern und sich somit bewusst gegen „Muttersprachenmord“ stellt, wird mit einer um einen Grad schlechteren Note bestraft.
Das Thema Gendern durfte ich leider während der Arbeit an meinem ersten Buch nicht mehr ignorieren. Dankenswerterweise korrigierte eine liebe Kollegin alle zu „männlichen“ Stellen. Infolgedessen kam ich zu dem Schluss: Nein, mir geht das zu weit! Ich mache bei dem Kasperltheater nicht mit und ich darf das entscheiden, weil ich eine Frau bin. (Mein tiefes Mitgefühl für meine männlichen Kollegen!)
Bei meinem zweiten Buch habe ich nicht mehr gegendert, genauso, wie ich es in allen Blogbeiträgen absichtlich nicht tue. Es tut mir für die großartige Lektorin des Verlages leid, die zwar insgesamt kaum Arbeit mit meinem Text hatte, aber bei den Nomen häufig „:innen“ hinzufügen musste. Sie hatte keine Wahl, aber ich füge mich dem Schwachsinn nicht. Abgesehen davon, dass nicht gegenderter Inhalt beim Lesen deutlich leichter verstanden wird, sind Autoren an eine Maximalzahl geschriebener Zeichen gebunden. Werden an einen großen Teil der Nomen automatisch 6 Anschläge mehr angehängt, dann kommt gemessen an einem ganzen Buch eine Unzahl an unnötigen Zeichen zusammen, auf deren Kosten sinnvolle Inhalte und Erklärungen gestrichen werden müssen.
Dass für eine einzelne weibliche Person die weibliche grammatikalische Form verwendet wird, ist unbestritten. Aber jedes Wort in einem Satz zweimal zu sagen und einmal *innen anzuhängen, nervt. Der Hör- und Lesefluss wird meinem Empfinden nach merklich eingeschränkt. Sogar laut Duden 2020 wird das Binnen-I „vom amtlichen Regelwerk nicht abgedeckt“. Weniger elegant, dafür viel treffender ist der Ausdruck „Sprachverhunzung“. Ist das wirklich die einzige Möglichkeit, die Wertigkeit von Frauen und Männern gleichzusetzen? Wenn ich allerdings die Diffamierung weißer, heterosexueller Männer in den letzten Jahren beobachte, dann frage ich mich, ob Frauen überhaupt gleichgestellt werden wollen.
Nun ja, zurück zum Thema: Sinn des Genderns ist, dass sich Frauen in ihrem Frau-Sein nicht entwertet fühlen. Und das gelingt mit einem Sternchen oder einem Doppelpunkt? Ich fühle mich nicht in meinem Frau-Sein entwertet, wenn der Radiomoderator „liebe Zuhörer“ sagt oder wenn über dem Zutritt in ein öffentliches Gebäude „Besuchereingang“ steht.
Aber ich fühle mich in meinem Frau-Sein entwertet, wenn abfällig von Frauen gesprochen wird, die im Sinne ihrer Kinder entscheiden, länger in Karenz zu bleiben, um die physische, psychische und kognitive Entwicklung ihres Babys intensiver zu begleiten. Ginge es tatsächlich um mehr Wertschätzung, dann müsste die Rolle als Mutter und Mitte der Familie mehr gewürdigt werden anstatt den gesellschaftlich auferlegten Druck zu verstärken, sein Baby möglichst schnell fremdbetreuen zu lassen und entsprechend rasch an den Arbeitsplatz zurückzukehren.
Ich fühle mich in meinem Frau-sein entwertet, wenn von einer Frauen-Quote gesprochen wird. Wenn die Einhaltung einer Quote der Grund dafür ist, einen Arbeitsplatz an eine Frau zu vergeben, ist das ein Schlag ins Gesicht. Es ist für das optimale Vorankommen notwendig, dass der für die Position qualifizierteste Mensch eingestellt wird, egal welches der beiden Geschlechter er hat. In manchen Bereichen mag es sein, dass dort mehr Männer, in anderen wiederum, dass da mehr Frauen angestellt sind.
Ich fühle mich in meinem Frau-sein entwertet, wenn das Wort Mutter oder Begriffe in diesem Kontext oder auch die Bezeichnung von weiblichen Körperteilen bewusst verändert werden. Ich will keinen gebärdenden und zeugenden Elternteil und ich möchte nicht, dass von der Vagina als „Hole“ gesprochen wird. Biologisch gesehen gibt es zwei Geschlechter und in sehr, sehr seltenen Fällen eine Mischform. Aus einem Mädchen wird irgendwann eine Frau und viele Frauen entschließen sich, zu gebären. Sie sind dann eine Mutter, ihr Baby trinkt Muttermilch, erhält Mutterliebe und lernt die Muttersprache. Political Correctness hin oder her!
Die Sache genauer analysierend, komme ich zu dem Schluss, dass gendergerechte Sprache gar nicht (mehr) auf die Gleichstellung der Geschlechter abzielt, denn sonst könnte alles Weibliche doch weiterhin weiblich ausgedrückt werden. Es scheint mir eher ein Streben nach non-binären Ausdrücken zu sein, bei dem man weder Frau noch Mann anspricht, um jenen Menschen entgegenzukommen, die sich weder als das eine noch als das andere fühlen, wie in dem Artikel „Minenfeld Gendersternchen“ thematisiert: „Doch auch das Binnen-I ist nicht unumstritten – ignoriert es doch die geschlechtliche Vielfalt ausserhalb des Mann-Frau-Schemas.“ (Schweizer Schreibweise ohne ß)
Selbstverständlich bin ich dafür, dass jeder Mensch, der mit einer Situation (beispielsweise dem eigenen Geschlecht) unglücklich ist, diese ändert. Selbstverständlich muss in der Bevölkerung die nötige Toleranz und das Bewusstsein herrschen, diese Menschen in ihrer Problematik zu unterstützen. Es handelt sich allerdings um einen Bevölkerungsanteil von unter 1%. Im Umkehrschluss bedeutet das, dass über 99% der Bevölkerung mit ihrem Geschlecht zufrieden sind und somit auf die weibliche oder die männliche Form der Ansprache reagieren. Sie sind berechtigterweise dagegen, dass unsere Kultur und unsere Sprache bewusst verändert wird.
Wenn die Rücksichtnahme in der Wortwahl so entscheidend ist, dass sich 99% der Bevölkerung den Bedürfnissen einer kleinen Minderheit beugen müssen, wieso gibt es keine Forderung nach Anpassung den Bevölkerungsgruppen zuliebe, die eine Minderheit von 15 oder 20% darstellen? Beispiele gefällig?
Offiziell sind 15% der Menschen in Europa Linkshänder. Entsprechende Untersuchungen zeigen aber einen deutlich höheren Prozentsatz. Viele Kinder stellen sich schon im Kindergartenalter freiwillig und von Erwachsenen unbemerkt auf rechts um, aus dem kindlichen/menschlichen Bedürfnis heraus, nicht anders sein zu wollen. Das kann zu erheblichen Lernschwierigkeiten führen! Auch Alltägliches (Bügeltische, Türöffner, Brotschneidemaschinen etc.) ist ganz selbstverständlich an Rechtshändigkeit ausgerichtet. Viele gesellschaftliche Gewohnheiten wie das Händeschütteln werden mit rechts gemacht. Sogar Worte – da sind wir wieder zurück beim Thema „Sprache“ – drücken Herabschätzung aus, wenn man an Phrasen wie „linkisch“ oder jemanden „linken“ denkt. Sie werfen unbewusst ein schlechtes Licht auf Linkshänder. Warum werden diese Ausdrücke nicht umformuliert?
Eine andere Minderheit, deren Anteil mindestens bei 10-15% liegt, sind dyslektische Menschen, also jene, die mit zweidimensionalen Zeichen wie Buchstaben oder Zahlen auf Kriegsfuß stehen. Sie leiden schon als Kind unter teils gravierenden Lese-, Rechtschreib- und/oder Rechenproblemen, erhalten aber in unserem Schulsystem leider nur theoretisch Verständnis, indem es formell einen Legasthenieerlass gibt, an den sich in der Praxis kaum ein Lehrer hält. Man kann nur erahnen, wie verwirrend für leseschwache Menschen die Sternchen und Doppelpunkte innerhalb der Worte sind.
Aber auch Volksschulkinder ohne Lese- oder Schreibproblematik können Angaben im Deutschbuch wie: „Eine/r ist Zuhörer/in, der/die andere ist Vorleser/in. Eine/r liest den Abschnitt vor, der/die Zuhörer/in fasst das Gehörte zusammen“, nicht automatisiert verstehen. Übrigens auch viele Erwachsene nicht.
Speziell das oben angeführte „der/die“ macht Menschen, deren Muttersprache nicht Deutsch ist, große Probleme. Deutsche Artikel werden mit den Fällen mitdekliniert, was für Deutschlernende ohnehin herausfordernd ist. Das doppelte Anführen von Wortbegleitern, um einer Geschlechterthematik gerecht zu werden, die laut Umfragen 85% der Muttersprachler selbst ablehnen, erzeugt nur noch mehr Verwirrung.
Ich bin sehr froh, dass die Sprachverunstalter noch nicht auf die diskriminierenden Artikel aufmerksam wurden. Man denke an das böse „Das“, wenn es sich um das Wort „Mädchen“ handelt oder an „die“ und „der“, die auch in anderen Fällen vorkommen als im Nominativ Singular, in dem sie einem Wort ein grammatikalisches Geschlecht zuordnen. Bisher wird „die“ weiterhin bei der Verwendung des Nominativs und des Akkusativs im Plural zugelassen genauso wie „der“ als Artikel im Genitiv oder Dativ bei grammatikalisch weiblichem Worten. Heißt es doch noch immer „Das Buch der Frau“ oder „Ich spreche mit der Frau“. Wie lange darf das wohl noch so bleiben?
Es kommt mir so vor, als würde man Frauen, die laut nach Gleichberechtigung rufen, mit diesen linguistischen Anpassungen ruhigstellen wollen. Dass die Sicht auf Frauen, wie in dieser Dr. Oetker Werbung aus dem Jahr 1954, einer vehementen Gegenreaktion bedurfte, ist diskussionslos. Aber jedes Pendel, das weit ausschlägt, findet irgendwann wieder seine Mitte.
Und es ist nun Zeit für diese Mitte! Begegnung auf Augenhöhe passiert nicht durch die Buchstabenkombination I-N-N-E-N, sondern durch die Aufwertung von unbezahlter Arbeit. Gemeint sind damit jene Tätigkeiten im Alltag, die nach wie vor neben dem obligatorischen Full-Time-Job ganz selbstverständlich zum Großteil von Frauen verrichtet werden, wie Haushalt, Erziehung, Altenpflege oder ehrenamtliche Aufgaben, während Männer in den meisten Familien weiterhin mehr Stunden in bezahlter Tätigkeit verbringen. Beides ist gleich wichtig und gleich wertvoll, damit das Zusammenleben strukturiert und organisiert abläuft. Deshalb ist jegliche Abwertung von Leistungen sowohl jener von Männern als auch jener von Frauen toxisch für Beziehungen und stört die Familienharmonie. Das kann nicht von einer weiblichen Wortendung ausgeglichen werden.
Credits
| Image | Title | Autor | License |
|---|---|---|---|
 |
WG – 2023 KW30-31-YOUTUBE-PC | Wolfgang Müller | CC BY-SA 4.0 |
 |
In-der-Genderfalle-Podcast | ||
 |
Blog – In der Genderfalle-YOUTUBE_PC | Wolfgang Müller | CC BY-SA 4.0 |

Sehr geehrte Frau Kostka, ich habe mit sehr viel Interesse Ihren Artikel gelesen.
Sie schreiben: „Nun ja, zurück zum Thema: Sinn des Genderns ist, dass sich Frauen in ihrem Frau-Sein nicht entwertet fühlen.“
Für mich geht es nicht darum, dass sich Frauen nicht entwertet fühlen. Vielmehr geht es darum, dass Frauen SICHTBAR werden. Und das gelingt eben nicht über das Generische Maskulinum. Aus diesem Grund ist das „Gendern“ so wichtig.
Danke für alle anderen Aspekte und Argumente in Ihrem Artikel.
Ich bin als Frau in meinem letzten Lebesdrittel angekommen, und habe die Erfahrung gemacht, dass das SICHTBAR machen der Frauen, keinesfalls durch eine Sprachverunstaltung erreicht werden kann. Verstehe aber, was Sie damit meinen.
Liebe Frau Köslin,
ich freue mich, dass Sie den Beitrag gelesen haben und danke Ihnen für Ihre Zeit, ihn zu kommentieren.
Natürlich stimmt es, dass etwas, was ständig präsent ist, sichtbarer ist. Von dem Aspekt her haben Sie natürlich recht.
Aber es kann auch passieren, dass ein zu häufiges, zu vehementes Hinweisen genau das Gegenteil von dem erzeugt, was die ursprüngliche Intention war. Nämlich, dass es einem großen Teil der Bevölkerung so sehr auf die Nerven geht, dass sie beginnen das Thema zu ignorieren oder bewusst zu vermeiden, vielleicht sogar abzulehnen.
Wenn ich mich im Freundeskreis, in der Familie, bei meinen Kunden oder Kollegen umhöre, dann scheint es mir, als wäre genau das beim Thema „Gendern“ bereits passiert. Die Bevölkerung ist völlig überreizt. Es ist so müßig, umständlich und das Verständnis erschwerend, dass die meisten Menschen die Augen verdrehen, wenn man – wie ich in den letzten Wochen in Vorbereitung auf den Artikel – bewusst nach ihrer Meinung dazu fragt. Sie sind es leid.
Ein wenig erinnert es mich an die Ehe meiner Großeltern, in der mein Großvater die allgegenwärtigen Nörgeleien meiner Großmutter einfach nicht mehr gehört hat.
Ich verstehe aber auch, dass es Menschen gibt, denen das Thema wichtig ist. Selbstverständlich! Die Bandbreite an Meinungen zu jedem Thema ist vielfältig und so soll sie auch sein! Gott sei Dank ist das Leben nicht schwarz oder weiß, sondern hat tausende Schattierungen dazwischen.
Und genau deshalb finde ich, dass jedem mündigen Menschen selbst überlassen werden sollte, wie er sich ausdrückt. Ob ein Text aus welchen Beweggründen auch immer die weibliche Form hervorhebt oder ob er so verfasst ist, dass der Lesefluss leichter, dafür in einem allgemeineren Ton gehalten ist, sollte einzig dem Autor überlassen bleiben.
Auch dass Universitäten und sogar schon höhere Schulen um einen Grad schlechter benoten, finde ich nicht gerechtfertig, da gendern oder nicht gendern mit der Wissenschaftlichkeit, die in oder hinter der Arbeit steckt nichts zu tun hat, sofern es das Thema an sich nicht erfordert und in den seltensten Fällen ist das der Fall.
Vergleiche ich das Leben jetzt mit dem vor 20 oder 30 Jahren stelle ich fest, dass wir ein sehr, sehr großes Stück persönlicher Freiheit eingebüßt haben. Regeln und Paragraphen wachsen uns schon über den Kopf. Zensur, Manipulation, sogar Propaganda sind teils versteckt, teils sogar erkennbar vorhanden.
Ich habe einen Zweitwohnsitz in einem Nachbarland und bin daher mehrmals im Monat dort. Schon beim Überqueren der Grenze spüre ich eine Freiheit, die es in Österreich nicht mehr gibt, die es aber in meiner Jugend gegeben hat. Beim Zurückkommen „nach Hause“ fühlt es sich beklemmend an, weil unser Leben von verschiedensten Behörden über-reglementiert ist.
Wenn Vorschriften und Kontrollen sogar so weit gehen, dass ich mich in meiner Muttersprache nicht mehr frei ausdrücken darf, obwohl ich dabei niemanden beleidige, dann empfinde ich persönlich das als massive Grenzüberschreitung und bis zu einem gewissen Grad auch Einschränkung meiner Kreativität.
Ich bin der Meinung, dass sämtliche Regeln dazu fallen sollten und jene Menschen, die gerne gendern möchten, dies in ihren Texten tun. Und dass jene, die nicht gendern möchte, es nicht tun. So, wie das in einer Demokratie, die die persönliche Freiheit jedes Menschen nicht nur zulässt, sondern auch diskussionslos unterstützt, der Fall sein sollte.
Ich danke Ihnen für den Austausch, da nur dieser die Themen belebt und hoffe, dass ich die Hintergründe meiner Meinung verständlich darlegen konnte.
Herzliche Grüße
Simone Kostka
Ein großartiger Beitrag, der genau das anspricht, was die Mehrheit der Frauen empfinden. Gleichstellung der Frau bitte dort, wo es lebensnah und sinnvoll ist und der Gesellschaft und Famile Vorteile bringt. z.B Gleiche Gehälter für gleiche Leistung. Gleichstellung der Frau geschieht nicht durch „INNEN“ hinten anzuhängen.
Liebe Frau Eisenkirchner,
herzlichen Dank für das Nutzen unserer Kommentarfunktion! Es ist schön zu hören, dass Sie der Inhalt offenbar sehr angesprochen hat. Besonders wichtig sind uns in diesem Zusammenhang natürlich die Rückmeldungen weiblicher Leser, weil es selbstredend ein Thema ist, bei dem es meistens eine Spaltung in Frauen-pro und Männer-contra gib. Aber offenbar ändert sich die Lage diesbezüglich gerade.
Danke nochmals und viele liebe Grüße
Simone Kostka